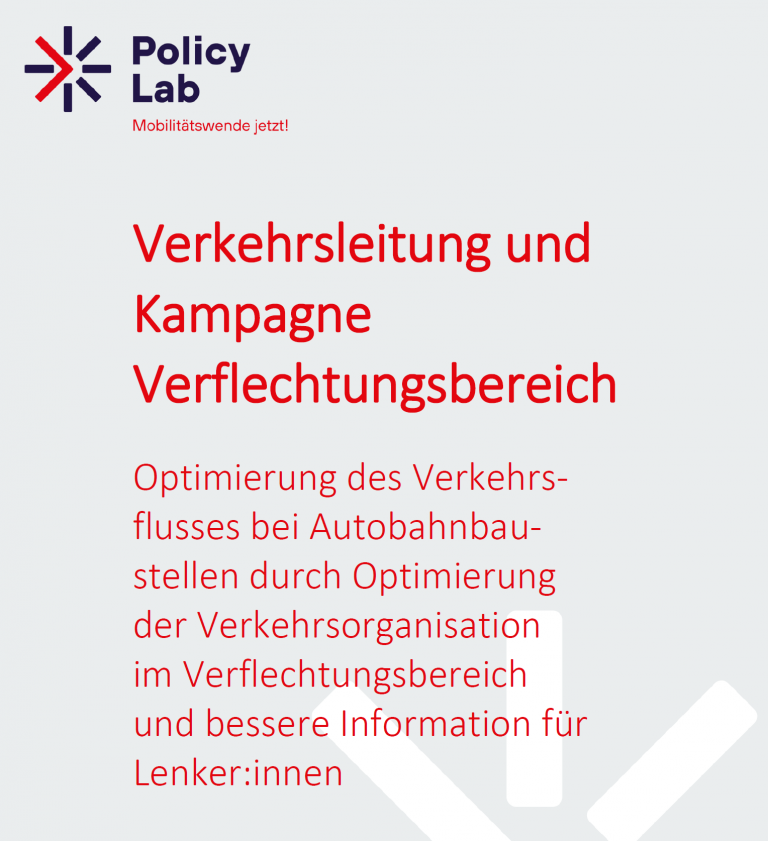Ausgangslage des Projekts
Die Errichtung von Stellplätzen ist grundsätzlich teuer und bindet wertvolle Ressourcen (z.B. Bodenflächen) die für andere Verwendungen nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie hat aber auch eine Fülle weiterer negativer Wirkungen zur Folge. Dazu zählen etwa die Verfestigung der Autoabhängigkeit, Bodenversiegelung, Zersiedelung oder die Verteuerung von Wohnraum. In diesem Projekt erfolgt eine Befassung mit den Kosten und Folgewirkungen der Errichtung von KFZ-Stellplätzen.
Relevanz
Primär ist das Projekt auf die Gegebenheiten in Tirol ausgerichtet (z.B. Immobilienpreise betreffend). Grundsätzlich sind die Ergebnisse jedoch übertragbar auf ganz Österreich und darüber hinaus.
Zentrale Zielsetzung des Projekts
Übergeordnetes Ziel der Recherche ist es, einen Überblick über die Kostenkomponenten von PKW-Stellplätzen in Tirol zu geben und in Form einiger repräsentativer Anwendungsfälle quantitativ darzustellen. Ergänzt wird die Analyse durch qualitative Aussagen zu volkswirtschaftlichen Kosten, Rebound-Effekten und Folgewirkungen, die mit der Errichtung von PKW-Stellplätzen verbunden sind.
Zentrale Projektaktivitäten
- Umfassende Recherche zu Kosten und ihren Schwankungsbreiten, systematisiert nach allen relevanten Kostenkomponenten:
- Grunderwerbskosten
- Errichtungskosten
- Laufende Kosten bezogen auf eine Betrachtungsperiode von 20 Jahren
- GIS-Analysen (Raumtypen, Immobilienpreise, Widmungen)
- Redaktionelle und grafische Aufbereitung der Recherche-ergebnisse
- Erarbeitung eines Argumentariums für die Bedarfsträger*innen
Erlangte Kern-Erkenntnisse aus dem Projekt
In der Studie wurden die einzelnen Kostenkomponenten und ihre jeweiligen Schwankungsbreiten in übersichtlicher Form dargestellt, und als Rechenmodell mit Eingabemaske verfügbar gemacht. Anhand einiger repräsentativer Use-Cases (betriebliche Mobilität, touristische Anwendungsfälle, oder kommunale PKW-Stellplätze im öffentlichen Raum) wurden die Kosten pro Stellplatz je nach Lage (Raumtyp), baulicher Ausgestaltung und anderen Faktoren ermittelt. Betrachtet werden sowohl Errichtungskosten, laufende Kosten als auch die Grunderwerbskosten. Die Ergebnisse und Berechnungen werden 2025 veröffentlicht.
Die Aufstellung der Kosten dient v.a. dazu, das Bewusstsein für die direkten und indirekten Kosten von Stellplätzen bei den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung zu schärfen und Wege aufzuzeigen, inwieweit Mittel und Flächen für andere Zwecke genutzt werden können. Für einen Großteil der Haushalte in Österreich spielt der PKW nach wie vor eine zentrale Rolle: Arbeitswege, Bring- und Holwege, Einkaufen, etc. sind Gründe für häufige PKW-Nutzung. Solche Mobilitätsstile sind allerdings wenig nachhaltig und mit den österreichischen Klimazielen nicht vereinbar, zudem bürden sie den privaten Haushalten sowie der Gesellschaft insgesamt hohe Kosten auf. Diese Konsummuster, bzw. Lebensstile verfestigen sich, wenn fortwährend Flächen als Stellplätze für PKWs (noch dazu meist gratis) zur Verfügung gestellt werden. Ähnliches gilt in Hinsicht auf Siedlungsstrukturen: anstatt kompakte Orte der ‚kurzen Wege‘ zu planen, gibt es auf der ‚grüne Wiese‘ nach wie vor sehr viel Bautätigkeit (Wohnen, Versorgung, Wirtschaft etc.), die wiederum die Errichtung von Stellplätzen bedingt, um überhaupt funktionsfähig zu sein. Wenn es darum geht, neue Mobilitätsangebote zu etablieren, um aus dieser Autoabhängigkeit wieder herauszukommen, ist die Errichtung von Stellplätzen daher in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv.
- Projektzeitraum: November 2023 bis April 2024
- Initialpartner: Land Tirol
- Umsetzende Organisation: tbw research
- Kontaktperson: Roland Hackl
- Email: r.hackl@tbwresearch.org